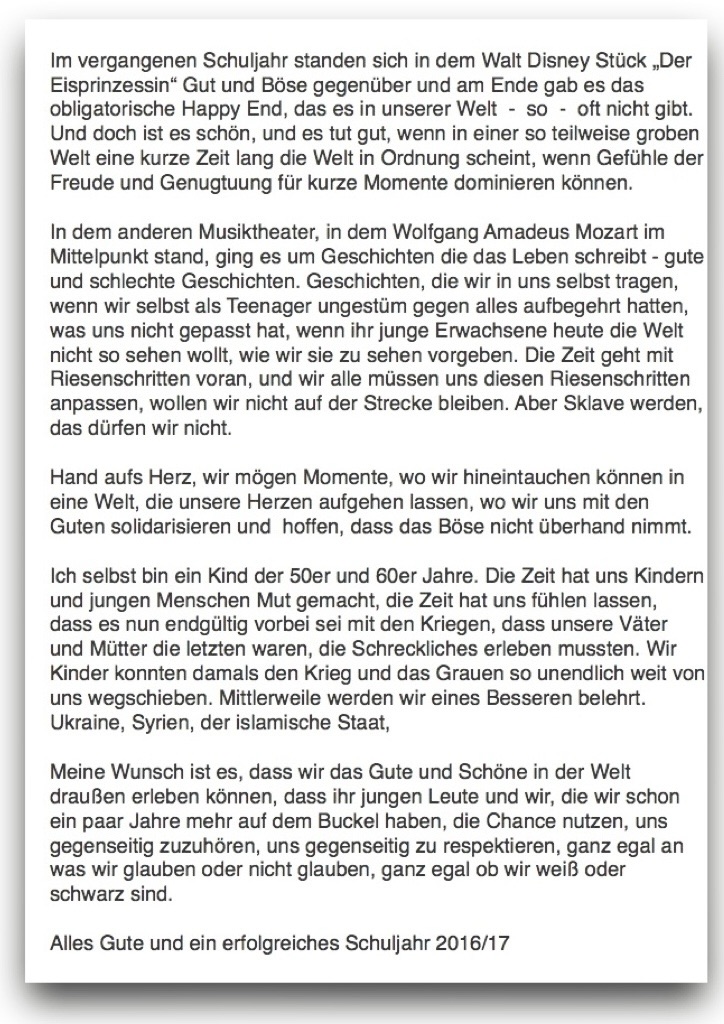1954 wurde ich in ein Dorf hineingeboren, das nicht müde war, darauf zu vertrauen, dass nicht noch ein dritter Krieg das ganze Leid wieder von vorne beginnen lässt. Man baute auf die Vernunft einer neuen Generation.
Das Tretauto war aus Blech geschnitten, rot lackiert – mein Begleiter in den jungen Jahren. Mehr als 40 Jahre nach dem ersten großen Krieg, 20 Jahre nach der 2. Katastrophe. Vor der Haustür ein schmaler, staubiger Weg, kein Asphalt. Platz genug für mein Tretauto. Heute hat da kein Spielzeug mehr Platz. Als Sandwich geboren, viele Male von hinten und vorne zerdrückt, aber mein rotes Auto tat immer das, was ich wollte. Meinen Zorn bekam es zu spüren, auch meine Zärtlichkeit.
Es gab nur diese eine enge Welt: Mama, Papa, Opa und mich, eingeklemmt zwischen Bruder und Schwester. Folgsam sein war das Gebot der Zeit. Gehorsam, unterwürfig und selbstverständlich katholisch. Sonst drohe die ewige Verdammnis. So wurde oft genug unser kleines Gehirn auf Linie gebracht. Die Hölle tat noch ihr übriges. War man nicht so auf Linie, dann war man der Luthrische. Papst- und Kirchentreue standen ganz oben an, zumindest offiziell. Vieles war schon damals sehr viel Schein. Gott, Kaiser und Vaterland hatten einen Knick bekommen. „Verlassen ganz von Gott und Kaiser Franz“ Irgendwann viel später hatte ich verstanden, dass das ganze Leid, alle Toten umsonst waren. Man kämpfte für das Vaterland Österreich, führte Befehle aus, auch strategisch miserable, wähnte sich Gott und den Kaiser hinter sich, und am Ende waren viele Leben zerstört, das Recht auf Leben viele tausend Male missachtet, junge Menschen als Kanonenfutter missbraucht. Ein paar Mythen verhübschten das Elend, und die Mächtigen übten sich in der Glorifizierung der toten Helden. Die, die Glück hatten und überlebten, bekamen Tapferkeitsmedaillen. Frauen, Mütter und Kinder, denen man ihre Männer und Väter weggeschossen hatte, büßten für etwas, wofür sie nichts konnten. Die Brandstifter saßen dort, wo keine Granaten und Gewehrsalven zu befürchten waren. An dieser Rollenverteilung hat sich bis heute nichts, aber schon gar nichts verändert; man denke an den Herrn Assad in Syrien, an Herrn Putin in Russland, ganz zu schweigen von Lukaschenko in Belarus, den Generälen in Myanmar, Xi Jinping in China usw. Die „Kaiser“ triumphieren oder sie triumphieren nicht – egal, die Untertanen haben zu gehorchen. Und sie haben zu schießen und zu sterben, wenn man es ihnen befiehlt.
Gewaltsames Sterben muss grausam sein. So dachte ich lange bevor ich erwachsen war, als junger Bub. Es ist alles vorbei. Nie wieder gibt es die Hoffnung, nie wieder die Sehnsüchte, die Träume. Ausradiert! Claus Gatterer schreibt in seinen Tagebüchern: „Er (der Tod) ist nicht süß, wie’s im Gedicht heißt…Das Vaterland wirft seine Söhne ins Massengrab – und oft genug den Raben zum Fraß vor.“ Gewaltsames Sterben vor 100 Jahren ist um nichts ein anderes als es heute ist. Ist es tatsächlich Vorsehung, wie Luise Rogger 1914 ihrem Mann an die Front in Galizien schreibt: „…Wie es die göttliche Vorsehung bestimmt hat, so wird es kommen….für den einen Leben, für den anderen der Tod“ Ebenso ist es 100 Jahre her, dass Josef Tschurtschenthaler, von der Russenfront weit im Osten nach Hause schreibt: „….Bei Tag und Nacht, ohne Ruhe, immer das Sausen der Kanonen und Gewehrkugeln in den Ohren. Da schaut es ganz schrecklich aus. Drum, oh Gott, bewahre vom Kriege.“ Mittlerweile weiß ich, dass es nicht Gott ist, der uns vor Krieg bewahren kann. Das müssen wir Menschen schon selber tun.
Der Kindergarten war schön, aber das obligatorische Nachmittagsschläfchen mochte ich absolut nicht: sitzend auf dem Stuhl vor dem Tisch, den Kopf in die verschränkten Arme gelegt und: „Jetzt wird geschlafen!“ In der Volksschule habe ich viel gelernt, sehr viel über unser schönes Land; aber über die Welt und die traumatischen Geschichtserreignsse war viel zu wenig dabei. Es stand nicht in den Lehrplänen, und Bücher dazu gab es sowieso keine. Nicht so erfreut waren wir, wenn man uns Buben und Mädchen in der Klasse an den Haaren gezogen hatte und der eine und die andere in die Ecke gehen musste, ich auch – in die Büßerecke – grauenhaft! Wenn uns Frau Lehrerin mit dem Haselnussstöckchen, meistens mehrere Schläge auf die ausgestreckten Finger draufgab, erfuhren wir Buben und Mädchen wie Linientreue auszusehen hat.
Wenn daheim von den beiden Kriegen gesprochen wurde, dann gab es in meinem Kopf ein höllisches Durcheinander. Mein Opa hat den 1. und 2. Krieg durchleben müssen, mein Vater und meine Mutter den 2. Was war vor 40 und was vor 20 Jahren? Ich konnte es nicht auf die Reihe bringen; ein Kuddelmuddel in meinem Kopf, mehr nicht. Ganz selten kam mein Opa mit einem Bild aus seinem Fotoalbum: 1915 – ein zerbombtes Sexten. 1923, so habe ich dies erst viel später realisiert, hat man den Abschluss des Wiederaufbaus gefeiert. Gern kramte Opa in jener Schublade im Wohnzimmer in der, schön gebündelt, die wertlosen österreichisch/ungarischen Kronen lagen. Oft brummte er gut hörbar vor sich hin, manchmal etwas lauter: „Wir haben für dieses Österreich, für diesen Kaiser gekämpft – alles umsonst, verpufft, verraten, in Stich gelassen.“ Wenn er schlecht drauf war, klang es sehr aggressiv, wenn es ihm gut ging, war zurückhaltende Ironie zu spüren. Und er konnte darüber sogar lachen, aber auch fluchen und aufbrausend schimpfen.
Damals war aber mein Tretauto auf der Straße vor dem Haus viel wichtiger als die alten Geschichten. Mitbekommen habe ich sie schon, verstehen und mir einen Reim daraus machen, das konnte ich damals nicht oder nur sehr bruchstückhaft. Wollten wir Kinder mal was nachfragen, was so häufig gar nicht war, dann hieß es, dass wir das sowieso nicht verstehen würden. Ok, dann ging ich wieder zu meinen Legos und zu meinem Tretauto. „Das verstehst du nicht“, „du bist noch grün hinter den Ohren“, haben mir meine Spielsachen nie zugeflüstert. Sehr wohl verstanden hatten wir junge Buben und Mädchen die ständigen Hinweise auf den sparsameren Umgang mit dem, was auf den Mittagstisch kam. „Hätten wir das damals im Krieg gehabt, was ihr da in den Müllkübel werft, wir wären glücklich gewesen.“ Das war schon nervlich, was wir Buben und Mädchen immer und immer wieder zu hören bekamen. Verstanden habe ich es aber erst viel später.
Es ist seit diesen Tagen sehr viel Zeit vergangen, und aus heutiger Sicht betrachtet, waren meine Eltern und mein Opa auch nicht gerade erpicht, über diese grauenhaften Jahre nachzudenken und zu sprechen. Sie hatten überlebt, und es war ihnen ein Gräuel, uns Kindern zu erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Wie gesagt, Anlässe, danach zu fragen gab es nicht. Wenn wir mal zu fragen probierten oder wenn sich Fragen aufdrängten, weil die Großen unter sich doch hin und wieder Vergangenes aufblitzen ließen, dann war dies, wie bereits gesagt, nicht so recht angebracht, oder die Antworten waren so kompliziert, dass man tunlichst weiteres Nachfragen vermieden hatte. Und überhaupt, wieso sollten wir Kinder so viel danach fragen? Wir hatten doch alles, was wir brauchten. Wir freuten uns sogar auf unser Ausweichquartier im Sommer, wenn die Fremden unsere normalen Schlafkammern besetzten.
Ich konnte mir nur sehr zaghaft einen Reim darauf machen, was Krieg bedeutet, was Frauen, Männer und Kinder erleiden mussten, was es heißt, seine Heimat verlassen zu müssen, was es bedeutet, sich vor den Granaten zu verstecken, was es heißt, dass junge Burschen, Väter und Verliebte oben in Schnee und Eis gefallen sind. Also hatten die Großen wohl darin recht, zu behaupten, das würden wir ja sowieso nicht verstehen. Oder sie wollten uns vor den Traumata bewahren und uns für eine heilere Welt vorbereiten. Ich bin mir nicht sicher, was vernünftiger hätte sein können.
1965 jährten sich die schicksalhaften Ereignisse zum 50. Mal. Ich war 11 Jahre jung. Inwendig in meinem jungen Kopf hat sich viel getan. Nach außen hin durfte nicht viel gezeigt werden. Wenn man laut über Dinge nachdachte, die nicht der öffentlichen Moral entsprachen, musste das „Maul gehalten“ werden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – Mamas Worte. Am 4. Juli 1965 hat der Sender Bozen einen Bericht ausgestrahlt, in dem mein Opa die Geschehnisse um den Tod von Sepp Innerkofler repetierte. Mein Opa war als 17jähriger Bub bei dieser fliegenden Patroullie um Sepp Innerkofler mit dabei. Man stelle sich das mal vor: ein 17jähriger Bub ganz vorne an der Front, wo getötet wurde. Hätte es ihn auch erwischt, wir hätten einen Heldentoten mehr, aber viele Leben weniger. Mit einem alten Tonbandgerät hatte ich damals 1965 dieses Interview aufgezeichnet. Ich hütete dieses Band, als sei es mein bester Freund. Lange Zeit schien ich es vergessen zu haben. Dann nach vielen Jahren kramte ich es wieder heraus und setzte alles daran, es auf ein neues Format zu bringen. Die Cassette lief und lief, bis ich begriff, was ich als 11jähriger nicht verstehen konnte. Das Land schuf sich einen Mythos, einen Heldentod, der massive strategische Fehler kaschieren und vergessen lassen sollte. Machpolitik versagte auf erbärmliche Weise.
Eltern haben es den Schulen überlassen, uns die Bitterkeit der vergangenen Jahre zu erzählen. Zu hören bekamen wir aber dort vorwiegend die frühe Geschichte unserer Vorfahren. Und dies in einer permanenten Endlosschleife von sechs bis hinauf zur Oberschule. Man wollte nicht, oder man traute sich nicht. Die Schauplätze waren viel zu nah und deshalb viel zu gefährlich, sich auf Unangenehmes und Widersprüchliches einzulassen. Da ist es wesentlich einfacher, die ferne Geschichte, die keinem mehr weh tut, vermitteln zu wollen. Steinzeit, Bronzezeit, von den Anfängen bis herauf zum aufrechten Gang und zum Homo sapiens. Meisterhaft, wie die Geschichte der unmittelbareren Vergangenheit auf die Seite geschoben wurde. Zumindest fühlte ich mich irgendwann später, in meinen nicht mehr so jungen Jahren in dem Gefühl glücklich geborgen, dass Europa so etwas in Zukunft verhindern kann.
Rogger Hansjörg, 2021